literatur & frieden
„Die Tragödie des Einzelnen aus der Statistik der Millionen befreien“
Über Literatur und Frieden
Literatur und Frieden – wovon sprechen wir?
πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει. – Ungeheuer ist viel, und nichts ungeheurer als der Mensch.
Mit diesen Worten setzt der Chor der Antigone des Sophokles ein, mit diesen Worten beginnt die abendländische Kritik am Krieg – oder wohl nicht so sehr am Krieg selbst als an einer Kultur des Krieges und der Gewalt, die die Grundlage für eine Politik des Krieges darstellt (Sophokles 1982). Das griechische Wort deinos, das Hölderlin hier mit „ungeheuer“ übersetzt, hat ein weites Spektrum an Bedeutungen. Deinos umfasst sowohl furchtbar, schreckenerregend und gewaltig als auch wunderbar. Der Chor kommentiert, was dieses klassische Musterstück der Gewaltkritik als Handlung vorführt, nämlich dass der Mensch begabt ist zu den großartigsten wie zu den schrecklichsten Taten – nicht bloß ein homo sapiens, sondern zugleich, wie Edgar Morin sagt, ein homo demens (Morin 1974, 133 ff.). Die Antigone zeigt uns aber auch, wie vertrackt die Verhältnisse sich darstellen, wie schwierig die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht ist. Schließlich verkörpert und vertritt Kreon, der Herrscher, das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger nach Recht, Ordnung und Sicherheit. Damit ist es ihm leicht möglich, die schweigende Mehrheit auf seine Seite zu bringen. Antigone hingegen, mit ihrer Anteilnahme für den Feind, muss für diese Mehrheit unvernünftig, idealistisch, als ein Sicherheitsrisiko wirken. Solange im Paradigma einer Kultur der Gewalt und des Krieges gedacht wird, bleibt gar keine andere Wahl, als solche Störelemente einzumauern und sie nicht nur mund-tot zu machen, oder, in der modernen, zivilisierten Variante – sie auf fernen Inseln in Hochsicherheitsgefängnisse einzusperren, zu foltern und zu quälen.
Damit ist im Kern bereits das Wesentlichste angesprochen: Ob Krieg herrscht oder ob es den Menschen gelingt, ihre Konflikte friedlich zu regeln, ist weder vom Schicksal bestimmt, noch liegt es in der „Natur“ der Menschen. Kriege sind auch nicht einfach die Folge eines machtpolitischen Spiels oder nackter ökonomischer Interessen. Ob Gesellschaften es zustande bringen, Kriege abzuwenden und Frieden zu halten, hängt vielmehr auch ab von den Leidenschaften, denen sie sich ausliefern, von den Mythen, an die sie glauben, von den Ideen, die sie verfolgen, von den Entscheidungen, die sie treffen. Modern gesprochen: davon, wieweit eine Kultur der Gewalt die Gesellschaft dominiert bzw. wieweit eine Kultur des Friedens entwickelt ist. Doch die von den Menschen geschaffenen Verhältnisse, sogar ihre eigenen Handlungsweisen, treten ihnen als fremde Macht entgegen, die sie unterjocht, statt dass sie sie beherrschen. Somit erhält vieles den Anschein von Fatum und höherer Gewalt, was bloß Ausdruck menschlicher Gewalt ist. Es gilt daher, den Zwischenraum zwischen bewusstem Handeln und dem Ausgeliefertsein an den stummen Zwang der letztlich selbst geschaffenen Verhältnisse zu erweitern, den Raum der allmählichen Bewusstwerdung der Zusammenhänge, der schrittweisen Eroberung von mehr Verständnis und von mehr Freiheit. Dieser Zwischenraum, das ist (auch) der Raum der Literatur, die uns in immer anderen Erzählformen und Ausdrucksweisen, mit stets neuen Beispielen vor Augen führt, was das heißt: „Ungeheuer ist viel, und nichts ist ungeheurer als der Mensch.“
Schon in den frühesten Dokumenten der abendländischen Literatur [um mich auf unseren Kulturkreis zu beschränken], in der Ilias und der Odyssee, wird ein antiker Welt-Krieg in all seinen Grausamkeiten geschildert. Die Verknüpfung von staatspolitischen Interessen und persönlicher Eitelkeit, von Machtpolitik und Ideologie, von Fügung der Götter und Planung der Strategen, ist seither selten so anschaulich und überzeugend vorgeführt worden. Auch eines der ersten Dramen Griechenlands, Der Fall Milets, hat einen zeitgenössischen Krieg zum Thema, die Einnahme der kleinasiatischen griechischen Kolonie Milet durch die Perser. Es hatte eine ungeheure Wirkung auf das Publikum, wie Herodot berichtet:
„Als Phrynichos ein Drama Milets Fall gedichtet und zur Aufführung gebracht hat, in Tränen brach da die Hörerschaft aus, und sie bestraften ihn, weil er an heimisches Unglück sie erinnert, mit 1000 Drachmen, und bestimmten, nie mehr solle einer dieses Drama aufführen“ (Herodot, zitiert nach Flacelière, S. 218).
Literatur war also kriegskritisch, unbequem und offenbar oft auch unbeliebt – von ihren Anfängen an. Das heißt nicht, dass es nicht ebenfalls eine lange Tradition der Kunst und Literatur gibt, wo diese zur Repräsentation politischer Macht genutzt wird, als „Abschreckungs- und Zerstreuungskunst“, wie es Helmar Schramm einmal formuliert hat (Schramm 1990). Dennoch ist die moderne Literatur, als bewusst autonome Kunst, eine prinzipielle Absage an jegliche Herrschaft – die Proklamation der eigenen Unabhängigkeit. Von ihren Möglichkeiten und Erfahrungen, Krieg und Gewalt zu kritisieren und die Sehnsucht nach einer besseren Welt zu wecken und aufrechtzuerhalten, von diesen „Träumen vom neunten Land“ (Handke), soll in der Folge die Rede sein.
Ich möchte mich aber nicht darauf beschränken, am Beispiel bestimmter AutorInnen eine Fallstudie über Literatur, Gewalt und Frieden zu liefern. Mir geht es viel mehr um das grundsätzliche Verhältnis von Krieg und Literatur, von Poesie und Frieden. Dazu reicht es nicht, einzelne Belege dafür anzuführen, dass Literatur (zuweilen, oder auch oft) den Frieden thematisiert und Gewalt und Krieg kritisiert. Es genügt nicht einmal, anhand der Wirkungsgeschichte ausgewählter Werke zu zeigen, dass pazifistische und gewaltkritische literarische Texte (manchmal, eher selten) eine unmittelbare politische Wirkung entfalten, wie etwa Harriet Beecher-Stowes Onkel Toms Hütte, Bertha von Suttners Die Waffen nieder!, Lev Tolstojs Krieg und Frieden, Erich Marie Remarques Im Westen nicht Neues oder Das Feuer von Henri Barbusse. Es geht vielmehr darum, grundsätzlich zu fragen, wie eine Ästhetik der Gewaltkritik aussieht, die sich auch der Gewalt des Ästhetischen und des Ästhetischen der Gewalt bewusst ist.
Wenn wir über den Zusammenhang von Literatur und Frieden sprechen, sprechen wir also nicht bloß darüber, wie ein bestimmter Topos literarisch bearbeitet wird. Über Literatur und Frieden sprechen, heißt vor allem, über Literatur und Politik zu sprechen. Wer aber über Literatur und Politik spricht, kann nicht anders als darüber zu reden, was das Eigentliche der Literatur ist. Über Literatur und Frieden sprechen, heißt also, Grundfragen des Literarischen aufzuwerfen. Ich möchte dies in Form von vier Thesen tun, die ich immer wieder mit Beispielen untermauern werde. Diese Beispiele sollen auch eine Ahnung von der Vielfalt der literarischen Verfahren und ästhetischen Techniken vermitteln, mit denen zeitgenössische Literatur arbeitet.
Vier Thesen
- Das Politische der Literatur liegt im Ästhetischen.
- Literatur kann nicht die Welt verändern, aber sie kann unsere Wahrnehmung der Welt verändern.
- Literatur kann unsere Fähigkeit stärken, um Menschen zu weinen, die nicht wir selbst sind und nicht zu uns gehören.
- Die Erkenntnisform der Literatur, und damit ihre „Objektivität“, ist ihre radikale Subjektivität.
Diese vier Punkte sind, wie sich bald herausstellen wird, nicht unabhängig von einander. Es sind verschiedene Aspekte, verschiedene Dimensionen ein und desselben Phänomens, die ich analytisch trenne, um das Phänomen literarische Gewaltkritik präziser beschreiben zu können.
Das Politische der Literatur liegt im Ästhetischen
Worin aber besteht das Politische? „Eine berühmte aristotelische Formel erklärt, dass die Menschen politische Wesen sind, weil sie die Sprache besitzen, die ihnen erlaubt, das Gerechte und das Ungerechte zu vergemeinschaften, während die Tiere nur die Stimme besitzen, die Lust und Schmerz ausdrückt. Aber die Frage ist gerade“, so der französische Philosoph Jacques Rancière, „wer befähigt ist, darüber zu urteilen, was eine beschlussfassende Sprache und was Ausdruck von Unlust ist. In gewisser Weise ist jede politische Aktivität ein Konflikt, in dem es darum geht zu entscheiden, wer befähigt ist, darüber zu urteilen, was Sprache und was Schrei ist […]“ (Rancière 2008, 13-14).
Indem Literatur sich einmischt, aus dem Schrei der von Gewalt Verfolgten Sprache macht, wirkt sie politisch. Aber es geht, wie anfangs angedeutet, um mehr. Jede Politik der Gewalt beruht auf einer Kultur der Gewalt – und mit Kultur sind hier die alltäglichen Praktiken ebenso gemeint wie die Deutungen und Erklärungen dieser Praktiken, bis hin zu legistischen Formen und materiellen Produkten. Ein Beispiel: Die Normalität, mit der bei uns „Fremde“ weniger Rechte zugestanden bekommen als die Einheimischen, gehört ebenso dazu wie entsprechende Rechtfertigungen: die Hinweise auf deren „Anderssein“ und mangelnde Anpassung an unsere Sprache, Lebensgewohnheiten, Reinlichkeitsrituale usw. Gerade weil diese alltägliche Praxis des Rassismus so selbstverständlich ist, bleibt sie auch so unsichtbar. Dass Politische an der Literatur ist es demnach, diese durch Selbstverständlichkeit unsichtbar gemachte Diskriminierung überhaupt erst wieder sichtbar und damit zum Skandal zu machen. Analoges gilt für die Frage nach Krieg und Frieden. Auch hier geht Literatur von einer weiten Perspektive aus. Sie stellt nicht einfach die Frage: Wann beginnt der Krieg? Sie interessiert sich noch viel mehr für die Frage, die Christa Wolf so formuliert hat: „Wann beginnt der Vorkrieg?“ (Wolf 1986, S. 78).
Aber ist es überhaupt die Aufgabe der Literatur sich in die Politik einzumischen? Es gibt eine lange Debatte über die Frage, ob sich moderne Kunst und politische Parteinahme vertragen, ob „ein politisch Lied ein garstig Lied“ ist. Nach einer bestimmten Logik sind Politik und Literatur tatsächlich Gegensätze – wenn man eine absolut autonom verstandene Kunst der profanen Welt entgegenstellt. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass die seit dem 18. Jahrhundert proklamierte Autonomie der Kunst zwar ein Schritt zu ihrer Vermarktbarkeit war, aber als solcher auch ein Akt der Befreiung aus den Zwängen der Repräsentation, also der ökonomischen und politischen Abhängigkeit der fürstlichen Macht. Die Proklamation von der Freiheit der Kunst, die Forderung, dass die Kunst nur der Kunst dienen dürfe, dass sie nur nach ihren eigenen Maßstäben gemessen werden dürfe, ist also keineswegs unpolitisch und weltabgewandt, sondern selbst ein politischer Anspruch, eben der nach einem selbständigen Agieren.
Dennoch tritt der Diskurs Ethik versus Ästhetik in verschiedensten Charaktermasken und Oppositionen stets von neuem auf – als die Frage, ob und, wenn überhaupt, wie Literatur Kritik an gesellschaftlichen Zuständen üben kann, ohne ihren künstlerischen Auftrag zu verraten. Der Diskurs erscheint als der sogenannte Realismusstreit, d. h. die Brecht-Lukács Debatte, als littérature engagée versus autonome Kunst, d. h. Sartre gegen seine Kritiker, als Adornos Diktum, “Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch”, oder als der Vorwurf der 68er Literaten, dass die Literatur nicht tauge, die Welt zu verändern, wie auch als Kritik an einer sich politisch wollenden Literatur, die doch nur Kolportage sei – „So fühlt man Absicht und man ist verstimmt” (Tasso II,1) usw. Diese Debatten, soviel sie auch dazu beigetragen haben, unser Verständnis für literarische Formen und Ausdrucksmöglichkeiten zu schärfen, scheinen dennoch den Kern der Problematik zu verfehlen. Das liegt nicht nur daran, dass gerade diejenigen, die sich selbst als „Bewohner des Elfenbeinturms“ stilisieren, wie Peter Handke, sich als schärfster politischer Kritiker von Kriegen (etwa Jugoslawien 1999) erweisen. Sondern es ist vor allem eine Tatsache, dass es trotz der Skepsis, die in den Debatten zum Ausdruck kommt, seit Jahr und Tag eine politische Literatur gibt, eine Literatur, die – mit welchen ästhetischen Mitteln auch immer – gegen Gewalt und Krieg Partei ergreift. Vielleicht müsste man sogar sagen, dass es gar nicht leicht ist, gegenwärtige literarische Werke zu finden, die die Gewaltbeziehungen, die das Zusammenleben der Menschen charakterisieren, ausklammern, als natürlich und unveränderbar darstellen oder gar verherrlichen.
Wie sehr Literatur sich gegen Gewalt einsetzt, sieht man auch an all den Beispielen, wo AutorInnen ihrer Literatur wegen verfolgt werden. Man denke an die Morddrohungen gegen Salman Rushdie, an zahlreiche Zensurmaßnahmen in vielen Ländern, und das nicht nur in autoritären Diktaturen. Ein Beispiel aus der „freien Welt“ wären die Gedichte der Häftlinge in Guantánamo. Es liegt dazu eine schmale Anthologie von 22 ins Englische übersetzten Gedichten vor, die von MenschenrechtsaktivistInnen gesammelt wurden und die die Zensur der amerikanischen Militärbehörden überstanden haben. Allein der Häftling Shaikh Adurraheem Muslim Dost hat aber rund 25.000 Gedichtzeilen geschrieben, die vom Militär konfisziert wurden. Nach seiner Entlassung 2005 wurden ihm nur eine Handvoll Texte zurückgegeben. Das Pentagon argumentierte sein Verbot, den Großteil der Texte zu publizieren, damit, dass Lyrik „ihrem Inhalt und ihrer Form nach ein besonderes Risiko“ (Falkoff 2007, 4) für die nationale Sicherheit darstelle.
Was aber macht Lyrik, was macht Literatur zu so einem gefährlichen Phänomen? Wohl die Tatsache, dass Literatur eine nach wie vor sehr hellsichtige und insofern wirkungsmächtige Form der Erkenntnis ist: „Die Literatur ist unauflöslich eine Wissenschaft von der Gesellschaft und die Erschaffung einer neuen Mythologie“, sagt Jacques Rancière (2008, 33). Es sind gerade die spezifischen ästhetischen Verfahren der „autonomen“ Literatur, die einen neuen Blick auf die so genannte Wirklichkeit werfen und somit eine Kritik bestehender Zustände erlauben – ein Umstand, der Rancière von einer „Politik der Literatur“ sprechen lässt. Das Politische ist also nichts Äußerliches, das zum Literarischen wie ein Fremdkörper hinzutritt, es ist auch keine spezifische Sprache, die sich grundlegend von der Alltagssprache unterscheiden würde – das Politische ist vielmehr eine bestimmte Konstellation, eine bestimmte Beziehung zwischen der Sprache der Literatur und der Welt. Milan Kundera (Kundera 2005, 84 f.) bringt dazu das Beispiel einer Geschichte von Kenzaburō Ōe Blökende Herde (1958). Es ist die Geschichte einer japanischen Stadt, in der ausländische Soldaten in einen Autobus einsteigen und einen Teil Passagiere demütigen. Die anderen schauen zu und schweigen. Der Dichter nennt aber die Nationalität der fremden Soldaten nicht. Hätte er einfach Amerikaner geschrieben (die natürlich gemeint sind), sagt Kundera, wäre diese eine banale, vordergründig politische Novelle geworden. Durch das Nichtbenennen eines einzigen Fakts erhält die Geschichte aber eine essentielle Bedeutung, so Kundera. Und ich möchte hinzufügen: Sobald die politischen „Reflexe“ ausgeschaltet werden, werden die grundlegenden Verhältnisse sichtbar, die weiter über das Einzelereignis hinaus für die Gesellschaft prägend sind. Auf diese Weise kann die Tiefenkultur aufgezeigt werden, die solche Demütigungen zulässt, eine Dimension der Kultur der Gewalt. Der Verzicht auf die vordergründige „Politik“ lässt das Politische erst sichtbar werden.[1] Die politischen Ereignisse selbst sind, wie schon Robert Musil wusste, „vertauschbar“, das Politische im tieferen Sinne ist im Poetischen aufgehoben.
Für den mexikanischen Schriftsteller Carlos Fuentes ist Literatur deswegen eine so wichtige Erkenntnisquelle, weil sie den Zweifel in die Gewissheiten hineinbringt.
„Die Zweifelhaftigkeit in einem Roman, die Ungewißheit über Autorschaft (und damit Autorität) und die Zulässigkeit vieler Erklärungen, ist vielleicht eine Methode, uns zu sagen, daß es mit der Welt ebenso bestellt ist. Wirklichkeit ist nicht fixiert, sie ist veränderlich. Wir können uns der Wirklichkeit nur annähern, wenn wir nicht vorgeben, sie ein für allemal zu definieren. Die von einem Roman vorgeschlagenen Teilwahrheiten sind eine Schutzwehr gegen dogmatische Zumutungen.“ (Fuentes 2005)
Ausgehend von ähnlichen Überlegungen habe ich in einer anderen Studie (Wintersteiner 2001b) vier Funktionen einer pazifistischen Literatur unterschieden: ihre (sprach-)kritische, ihre utopische, ihre empathische und ihre kathartische. Darauf möchte ich diesmal nicht genauer eingehen. Ich werde auch keine Ontologie oder Phänomenologie literarischer Kriegs- und Gewaltkritik vorlegen. Das wäre aussichtslos angesichts der Vielfalt der Formen und Ausdrucksmöglichkeiten, die so umfangreich sein können wie Tolstojs Krieg und Frieden oder Karl Kraus‘ Die letzten Tage der Menschheit, oder so kurz wie manche Notizen von Maruša Krese.[2] Ich werde mich vielmehr auf zwei, drei elementare Punkte beschränken, die für die politische und gewaltkritische Funktion von Literatur besonders relevant sind.
Literatur kann nicht die Welt verändern, aber sie verändert unsere Wahrnehmung der Welt
Kunst ist insofern eine spezifische Erkenntnisquelle, als sie über Verfahren verfügt, uns dazu zu bringen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, das, was die russischen Formalisten vor rund hundert Jahren als „Desautomatisierung der Wahrnehmung“ bezeichnet haben. Indem der oder die Dichterin ein Phänomen, einen Sachverhalt, ein Ereignis in einer Weise beschreibt, die anders ist, als wir es aus alltagssprachlichen Beschreibungen kennen, sehen wir die Dinge neu und anders, und vor allem, wir lernen auch, dass die Dinge anders sein können, als wir sie zu sehen gewohnt sind. Dazu Viktor Šklovskij: „Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstandes zu vermitteln, als Sehen, und nicht als Wiedererkennen; das Verfahren der Kunst ist das Verfahren der ‚Verfremdung‘ der Dinge und das Verfahren der erschwerten Form, ein Verfahren, das die Schwierigkeit und Länge der Wahrnehmung steigert, denn der Wahrnehmungsprozeß ist in der Kunst Selbstzweck und muß verlängert werden; die Kunst ist ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben; das Gemachte hingegen ist in der Kunst unwichtig. (Šklovskij 1971, 15).
Es ist interessant, dass Šklovskij als Kronzeugen für seine Theorie des Desautomatisierung der Wahrnehmung Lev Tolstoj heranzieht, mit einem Text über Gewalt, wo Tolstoj in damals ungewöhnlicher Präzision die Bestrafung von Gefangenen schildert – um die Mauer des „Wiedererkennens“ zu durchbrechen, die sich unweigerlich bei abgenutzten Informationen wie Bestrafung von Gefangenen bildet. Diese Verfahren der Verfremdung, die die Rezeption erschweren und damit die Wahrnehmung erst ermöglichen, können ganz unterschiedlich sein. Da es darum geht, dass bestehende Sehgewohnheiten immer neu infrage gestellt werden, müssen sie sogar immer neue Wege gehen. Anna Kim spricht daher in diesem Zusammenhang von experimentellem Schreiben: „Denkmuster, Gewohnheiten können gesprengt werden, indem man sie hinterfragt, Absurditäten aufdeckt, Ungereimtes. Dies zu bewerkstelligen, ist das Experiment mit dem Ausgangspunkt Gewohnheit und dem Ziel Ungewohntes, Anderes, Fremdes. Ein Beispiel: Ich überlege, wie ich einen Pfirsich beschreiben könnte. Sage ich, er ist behaart, rund, gelb und rosa, bleibe ich innerhalb der Konvention, und kein Experiment hat stattgefunden. Sage ich (und hier zitiere ich aus einer Zeitung) der Pfirsich sei wie ein Apfel mit Teppich, entziehe ich jeder Gewohnheit den Boden. Die erste Hypothese lautet daher: Das Mittel zur Aufdeckung der Realität ist das Experiment als adäquates Mittel der Subversion.” (Kim 2003)
Dazu noch ein Beispiel: „Krieg“, sagt Judith Butler, „lässt sich als ein Geschehen verstehen, das Bevölkerungen aufteilt in einerseits diejenigen, um die getrauert werden kann, und andererseits diejenigen, um die nicht getrauert werden kann. ‚Unbetrauerbar‘ in diesem, von der Logik des Krieges etablierten Sinn sind Leben, die nicht betrauert werden, weil ihnen zuvor bereits ihrer Existenz abgesprochen worden ist, weil sie nie als Leben zählten“ (Butler 2009, 18). Wir sprechen, zum Beispiel, von den rund 3000 Menschen, die den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 zum Opfer gefallen sind. Wir schweigen hingegen über den Kongokrieg, der von Mitte der 1990er Jahre bis Mitte des ersten Jahrzehnts im neuen Jahrhundert dauerte und nach verschiedenen Schätzungen zwischen 4 und 5,5 Millionen Tote forderte – die höchste Kriegsopferzahl seit 1945. Um Krieg zu führen, wird an unser tiefstes Mitgefühl appelliert – wenn es um die geht, die als die Eigenen betrachtet werden; und zugleich wird von uns radikale Blindheit erwartet, wenn es um die geht, die als die „Anderen“, die Feinde gesehen werden sollen. Ich habe schon das Beispiel der Antigone genannt. Das „Verbrechen“ der Antigone besteht darin, dass sie sich dieser binären Logik widersetzt – dass sie für den Feind, ihren Bruder Polyneikes, so viel Mitgefühl aufbringt, dass sie ihn bestattet. Sie nimmt ihn nicht als Feind wahr, sondern eben als ihren Bruder, einen Menschen, dem Leid widerfahren ist, der getötet wurde und dem Trauer und ein Begräbnis zustehen. Antigone widersetzt sich dem, was Judith Butler, den “Raster des Krieges” nennt (Butler 2010). Die Rahmung, der Raster der Wahrnehmung sind Bestandteil der Kriegspolitik, sind Bestandteil des Krieges. Anti-Kriegspolitik beginnt somit als ästhetisches Unterfangen, als Bemühung um Wahrnehmung derer, die nicht wahrgenommen und daher auch nicht in ihrer Opferrolle anerkannt werden können.
Diese Änderung des Denkrahmens, die erst die Wahrnehmung der Opfer ermöglicht, ist auch das Anliegen des israelischen Schriftstellers David Grossman. Für ihn lautet die Frage, was uns dazu bringt, Unrecht, Gewalt, Krieg und Völkermord zu akzeptieren, und sei es durch Ignorieren oder Stillschweigen. Grossman zeigt, mit welcher Leichtigkeit wir es schaffen, zwischen uns und dem Leid anderer Distanz zu schaffen.
„Der Tod eines Einzelnen ist eine Tragödie“, zitiert Grossman Stalin, „aber der Tod von Millionen nur eine Statistik“. Und er setzt fort: „Lassen Sie uns einen Moment darüber sprechen, auf welchem Weg sich eine Tragödie für uns in eine Statistik verwandelt. Ich möchte natürlich nicht behaupten, dass wir alle Mörder sind. Gewiss nicht. Und dennoch scheint es den meisten von uns zu gelingen, mit einer beinahe absoluten Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid ganzer Völker, nah und fern, zu leben – Gleichgültigkeit gegenüber der Not von Millionen von Menschen, die arm sind, hungrig, unterentwickelt und krank, ob in unseren Ländern oder auf anderen Erdteilen. Wir bringen es auch fertig, ungerührt und distanziert der Not der Ausländer gegenüberzustehen, die für uns arbeiten, und dem Elend der Völker, die sich in einem Zustand der Besatzung befinden – durch uns und andere –, und der Qual von Milliarden von Menschen, die unter Diktatur und Unterdrückung aller Art leiden“ (Grossman 2007, 89).
„Vielleicht erlaubt nur eine weltweite Realität, die zum größten Teil mit der Kategorie ‚Masse‘ zu beschreiben ist, die Realität eines ‚Lebens als Masse‘, zu einer derart leichtfertigen Gleichgültigkeit gegenüber Massenmord. Schließlich ist es ja gerade diese Gleichgültigkeit, die die Welt immer wieder demonstriert, ob in den Zeiten desVölkermordes an den Armeniern und den Juden, ob in Ruanda oder Bosnien, im Kongo, in Darfur und an vielen anderen Orten. Und möglicherweise lautet die große Frage, die wir uns heutzutage unentwegt stellen müssten: In welcher Situation, in welchem Moment werde ich zur ‚Masse‘?“ (Grossman 2007, 90-91).
Grossman schließt mit einer Bemerkung, die sich nicht nur auf die Produktionsästhetik bezieht, sondern die auch die Wirkungsästhetik der Literatur berücksichtigt, wenn er sagt, „dass das Geheimnis des Zaubers und der Größe der Literatur […], das Geheimnis, das uns immer wieder in ihre Arme treibt, voller Begeisterung, Erregung und Sehnsucht nach Schutz und Sinn […] darin liegt, dass sie für uns immer wieder die Tragödie des Einzelnen aus der Statistik der Millionen befreit. Des Einzelnen, von dem eine Geschichte handelt, und des Einzelnen, der diese Geschichte liest.“ (Grossman 2007, 99).
Während die Wissenschaftlerin Butler sich mehr für die politische Dimension, den Denkrahmen, interessiert, beschäftigt sich der Dichter Grossman mit der psychologischen und lesepsychologischen Dimension, nicht mit den objektiven, sondern mit den subjektiven Voraussetzungen unserer Aufnahmefähigkeit für fremdes Leid: „Das gute Buch […]“, sagt er, „macht den Leser einzigartig und befreit ihn aus der Menge. Es gibt ihm die Möglichkeit zu spüren, wie aus unbekannten Regionen Seeleninhalte, Erinnerungen und Existenzmöglichkeiten in ihm auftauchen und an die Oberfläche steigen, die ihm allein gehören und nur ihm. Die ausschließlich die Frucht seiner Persönlichkeit sind. Das Ergebnis seiner intimsten Schlussfolgerungen. Denn im alltäglichen Leben, in der Vulgarität des Alltags, in der allgemeinen Beschmutzung des Intellekts, der flachen, undifferenzierten Sprache, haben diese Seelenstoffe es schwer, aus jenen inneren Tiefen aufzusteigen und zu Wort zu kommen“ (Grossman 2007).
„Literatur kann unsere Fähigkeit stärken, um Menschen zu weinen, die nicht wir selbst sind und nicht zu uns gehören.“
In dieselbe Richtung noch einen Schritt weiter geht Susan Sontag, wenn sie einen Zusammenhang herstellt zwischen dem Rahmen unseres Denkens und den Voraussetzungen für unser Fühlen, die durch Literatur beeinflusst werden. „Literatur kann uns sagen, wie die Welt beschaffen ist. Literatur kann uns Maßstäbe geben, kann uns ein tiefes Wissen vermitteln, das in der Sprache und im Erzählen Gestalt annimmt. Literatur kann unsere Fähigkeit stärken, um Menschen zu weinen, die nicht wir selbst sind und nicht zu uns gehören.
Wer wären wir, wenn wir kein Mitgefühl für jene aufbringen könnten, die nicht wir selbst sind und die nicht zu uns gehören? Wer wären wir, wenn wir uns selbst nicht – wenigstens zeitweise – vergessen könnten? Wer wären wir, wenn wir nicht lernen könnten? Wenn wir nicht verzeihen könnten? Wenn wir nicht etwas anderes werden könnten, als wir sind?“ (Sontag 2003)
Bei Sontag wird der Zusammenhang von Erkenntnis und Fühlen deutlich – Denken und Emotion bilden keinen Gegensatz, sondern der Denkrahmen und der „Fühlrahmen“ bilden zusammen den Gesamtrahmen der Wahrnehmung. Empathie beruht also nicht bloß auf einer (vielleicht irrationalen) gefühlsmäßigen Neigung, sondern diese Neigung selbst korrespondiert mit einem intellektuellen Verständnis von Zusammenhängen.
Wichtig ist zu betonen, dass Sontags Anspruch deutlich über das hinausgeht, was uns in der Antigone vorgeführt wird, das heißt, was die Figur der Antigone an Einfühlungsvermögen mitbringt. Diese ist „nur“ mit ihrem Bruder beschäftigt – der zwar der Feind, aber zugleich ein Verwandter ist. Diese Opposition der feindlichen Brüder macht zwar den Konflikt besonders augenfällig und ist deswegen auch dramatisch sehr wirksam, aber zugleich entschärft sie Freund-Feind-Beziehung und relativiert damit die Empathieleistung der Antigone. Mitleid mit vollkommen Fremden oder Feinden finden wir hier noch nicht, wie auch die Athener Bürger über das Stück Der Fall Milets deswegen so erzürnt waren, weil es sie an das eigene Unglück erinnerte.[3]
Die Literaturhistorie ist voll von Geschichten, in denen die AutorInnen uns dazu bringen, um Menschen zu weinen, die nicht zu uns gehören. Das können tatsächlich die “Feinde” sein, wie etwa in Suttners Die Waffen nieder!, das sind aber nicht selten auch die sozial Deklassierten des “eigenen” Lagers, die Soldaten, die von Militärs gequält und schikaniert wurden und denen viele DichterInnen ein Denkmal gesetzt haben: Sei es Peter Niewiadomski, also Peter, der Unbekannte, der kleine huzulische Bahnarbeiter in Joseph Wittlins Das Salz der Erde, der zur k.u.k. Armee eingezogen wird – ein bemerkenswerter Antikriegsroman, weil er nämlich darauf verzichtet, den Krieg selbst darzustellen und sich damit begnügt, die Gewalttätigkeit und die dieser Gewalt zugleich innewohnenden Faszination bereits am Beispiel des Rekrutierungsprozesses der einfachen Leute festzumachen. Oder, um noch ein Beispiel zu nennen, Miroslav Krležas Antikriegsgeschichten, bei denen er sich der Opfer, der kleinen Honveds annimmt, der Landsturmmänner, die die Drecksarbeit des Krieges verrichten und die wie Dreck behandelt werden … All diese Erzählungen, Romane, Gedichte widersetzen sich den Paradigmen der Gewaltkultur, sind Ansätze einer Gegenkultur, oder, wie es Ingeborg Bachmann einmal in einem Gedicht gesagt hat: Sie orientieren sich am „armselige(n) Stern / der Hoffnung über dem Herzen“, der ihre schönste Auszeichnung ist (Bachmann 1957):

Er wird verliehen,
für die Flucht von den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtachtung
jeglichen Befehls.
Die Erkenntnisform der Literatur, und damit ihre „Objektivität“, ist ihre radikale Subjektivität
Im 19. Jahrhundert, und weit bis ins 20. Jahrhundert hinein, haben politische AutorInnen versucht, mit großen Romanen die Sozialstrukturen ihrer Gesellschaft nachzuzeichnen und offen zu legen. Von solchen Objektivitäts- und Totalitätsansprüchen hat sich die Postmoderne immer weiter entfernt. Ich möchte aber zeigen, dass das gerade Gegenteil – eine radikal subjektive Literatur – mindestens ebenso effiziente Mittel findet, eine Kultur der Gewalt offen zu legen und infrage zu stellen. Dazu nur zwei Beispiele:
Handkes literarische Medienkritik
Zunächst nenne ich Peter Handkes Kritik an der Medienberichterstattung über die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, also die ersten, zögerlichen und daher besonnenen Versuche einer literarisch-politischen Kritik.[4] Diese Kritik erfolgt durch einen Reisebericht, dessen ursprünglicher Titel sich bewusst anti-politisch gibt. Er vermeidet sogar die Nennung eines Ländernamens: Eine winterliche Reise zu den Flüssen, Donau, Save, Morawa und Drina. Dieser Bericht, zunächst in der Süddeutschen Zeitung erschienen, ist in bewusster Abgrenzung zu einer Kriegsberichterstattung geschrieben worden, die selbstsicher und ohne zu zögern die Wahrheiten des Krieges, die Einteilung in Feinde und Freunde verbreitet. Handke arbeitet fast völlig ohne Aufzeichnungen, er schreibt seinen Bericht Monate später aus dem Gedächtnis und filtert somit bereits die Ereignisse. Wie Goethe bei der Belagerung von Verdun scheint er sich manchmal mehr für Natureindrücke und das Wetter als für politische “Fakten” zu interessieren. Handke beschreibt das Flussufer der Donau und vergleicht den Strom mit der Donau in Wien. Er schildert Gasthausbesuche und Gespräche unter Freunden. Notiert, was er gegessen hat und was es am Markt zu kaufen gab. Der Text ist ganz sinnlich. Handke schildert nur das, was er selbst sieht, freilich beschreibt er sehr stark auch seine eigenen Empfindungen, Gefühle und Gedanken auf der Reise. Er polemisiert zuweilen heftig gegen eine einseitige Kriegsberichterstattung, die Serbien keine Gerechtigkeit angedeihen lassen will. Er stellt sich allerdings selbst immer wieder in Frage, er trägt, auch in der Form, Fragen an sich selbst heran. Das ist natürlich nicht objektiv, im Gegenteil. Es ist eine sehr persönliche Methode, Reiseeindrücke, Gehörtes und Gelesenes in Reflexionen und Selbstgesprächen festzuhalten. Es ist eine Kritik an einem medial produzierten Feindbild durch die hartnäckige Weigerung, dessen Stereotypen zu übernehmen. Das freilich hindert ihn nicht, seine eigenen Stereotypen zu pflegen und seine Idiosynkrasien zu entwickeln. Aber Handke bleibt sich dabei selbst treu, wenn er sein vielleicht nostalgisch wirkendes, deswegen aber nicht weniger sympathisches Credo schildert – die Hoffnung auf Wiederversöhnung der jugoslawischen Völker:
“Die bösen Fakten festhalten, schon recht. Für einen Frieden jedoch braucht es noch anderes, was nicht weniger ist als die Fakten. Kommst du jetzt mit dem Poetischen? Ja, wenn dieses als das gerade Gegenteil verstanden wird vom Nebulösen. Oder sag statt ‘das Poetische’ lieber das Verbindende, das Umfassende – den Anstoß zum gemeinsamen Erinnern, als der einzigen Versöhnungsmöglichkeit, für die zweite, die gemeinsame Kindheit” (Handke 1996, 133).
H.C. Artmann Manifest
Nun zu einem gänzlich anders gearteten Beispiel radikaler Subjektivät. H. C. Artmann legt seine Subjektivität in eine Textsorte hinein, die von ihrem Ziel her klar definiert und objektiviert ist, wenn es auch sprachliche Freiheiten geben mag – in ein politisches Manifest. Ich spreche von seinem Manifest gegen die Wiederbewaffnung Österreichs 1955. Er gewinnt dieser Textsorte somit eine neue Qualität ab, aus dem Politisch-Unpersönlichen, und dadurch Objektivität und allgemeine Gültigkeit beanspruchenden Text macht er einen radikal subjektiven, und damit wesentlich leidenschaftlicheren Appell, ohne deswegen den Anspruch auf Öffentlichkeit, auf die politische Aussage, im geringsten zurückzunehmen. Aus Politik macht er Poesie, könnte man sagen, die wiederum die Politik neu belebt. Die Sprache der Poesie als Jungbrunnen für die versteinerte, floskelhafte Sprache der Politik. Erst durch die Poesie beginnt die Politik wieder menschlich zu werden, das heißt aber, wirklich politisch zu werden. Denn wie Jacques Rancière uns erinnert, ist die Politik nicht die Einhaltung einer demokratiepolitischen Konvention und Sprache, sondern sie beginnt dort, wo jemand sich einmischt und fordert: Ich möchte gehört werden, weil dies ein Anliegen aller ist! In diesem Sinne kann man sagen: „Die Kunst ist die Politik“, wie Rancière es mit Berufung auf Gilles Deleuze formuliert (Rancière 2008, 13).
Artmanns Manifest, in der für ihn typischen Kleinschreibung verfasst, hebt sehr konventionell an, bricht aber den hohen Stil sofort durch eine der Alltagssprache entlehnte, kraftvoll-witzige Beschimpfung (Artmann 1969):
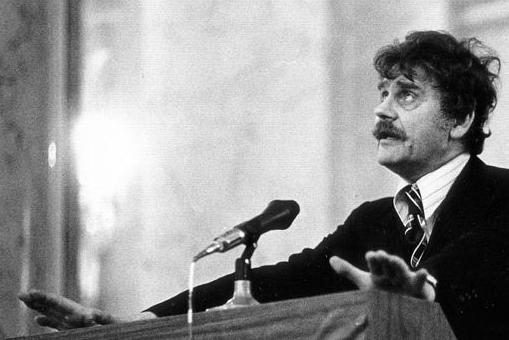
Wir protestieren mit allem nachdruck
gegen das makabre kasperltheater
welches bei wiedereinführung einer
wie auch immer gearteten wehrmacht
auf österreichischem boden
zur aufführung gelangen wuerde…
In diesem Stil, der den Jargon der empörten BürgerInnen von der Straße, nicht den geschliffenen Diskurs der Politiker nachahmt, geht es weiter:
Es ist eine bodenlose frechheit
eine unverschämtheit sondergleichen
zehn jahre hindurch
antimilitärische propaganda zu betreiben
scheinheilig schmutz und schund zu jaulen
zinnsoldaten und indianerfilme
(noch kleben die plakate …)
als unmoralisch zu deklarieren –
um dann
im ersten luftzug einer sogenannt
endgültigen freiheit
die kaum schulentwachsene jugend
an die dreckflinten zu pressen!!
Das ist atavismus !!!
Das ist Neanderthal !!!
Das ist vorbereitung
zum legalisierten menschenfressertum !!!
Wenn Artmann auch die Sprache eines Manifests poetisch unterläuft, der rhetorischen Form bleibt er durchaus treu. Aus der Anklage wird ein Appell, wenn auch einer, der in seiner rabiaten Art vor keinem Kalauer zurückschreckt:
Wir rufen euch alle auf:
wehrt euch gegen diese barbarei!
lasst euch nicht durch radetzky-deutschmeister und kaiserjägermarsch
aug und ohr auswischen …
pfeift auf den lorbeer
und lasst ihn den linsen !!!
denkt daran
welche ehre es für Österreich
bedeuten würde
bliebe es wie bisher
der einzige staat der welt
der diese unsägliche trottelei
den anderen dümmeren ueberlässt !!
genau so wie sich der kannibalismus
der urmenschen und höhlenbewohner
überlebt hat
muss nun endlich auch die soldatenspielerei
der vergangenheit überantwortet werden !!
Das Manifest endet schließlich mit einem witzigen poetischen Bild, welches aber den Ernst der Sache und des Engagements Artmanns und seiner sechs Mitstreiter keinen Abbruch tut. Im Gegenteil, das Bild ist nicht nur poetisch treffend gewählt, es ist auch politisch präzise. Es prophezeit in anschaulicher Form etwas, was sich bald danach als wahr herausstellen sollte: Dass sich nämlich ein Kleinstaat mit seinem Anspruch, sich gegen die Großen der Welt militärisch schützen zu können, gewaltig überhebt.
Ein Österreich
das nach wiederbewaffnung schreit
ist mit dem quakfrosch zu vergleichen
der mit bruchband und dextropur versehen
einen antiken dragonersäbel erheben wollte …
Ich möchte schließen mit einem Wort von Claudio Magris, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahr 2009. Er hat gesagt: “Wir wiegen uns in der Illusion, ohne Krieg zu leben, weil der Rhein keine von Hunderttausenden von Soldaten umkämpfte Grenze mehr ist, oder weil auf dem Karst hinter Triest nicht mehr diese Grenze verläuft, die der unüberwindbare Eiserne Vorhang war und ein Pulverfass zugleich. […] Heute ist diese Grenze nicht aufgehoben, sondern nur verschoben, um einen anderen, noch östlicheren Osten auszuschließen. Eine Grenze, die nicht als Durchgang, sondern als Mauer, als Bollwerk gegen die Barbaren, erlebt wird, bildet ein latentes Kriegspotenzial.” (Magris 2009)
Zu verhindern, dass diese Mauern, die wir nicht nur an den Rändern unseres Kontinents, sondern gleichermaßen im Innern unserer Städte und vor allem im Inneren unserer Köpfe finden, zu verhindern also, dass diese Mauern weiter wachsen, dazu kann Literatur Entscheidendes beitragen. Was wir tun können ist, mehr und bewusster von diesen Möglichkeiten der Literatur Gebrauch zu machen.
Fußnoten
[1] Zur Denkfigur der Unterscheidung zwischen der Politik und dem Politischen siehe Bedorf /Röttgers 2010.
[2] Vergleiche z. B.: „Ein Taxifahrer in New York: ‚We are saving the World.‘ Er ist überzeugt, dass es wirklich so ist. Soll ich ihm widersprechen? Ich nicke und bezahle. Von jetzt an nur noch U-Bahn, beschließe ich“ (Krese 2006, U4).
[3] Allerdings ist die Rezeptionsgeschichte der Antigone eine gute Illustration von Sontags Statement – seit über 2000 Jahren bringen wir Mitgefühl für eine Person auf, die nicht wir selbst ist und die nicht zu uns gehört, mehr noch, die überhaupt nur eine mythische Gestalt ist und niemals ein realer Mensch war.
[4] Auf die Problematik der Gesamtheit von Handkes Einstellung und Äußerungen zu den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien gehe ich hier gar nicht ein. Vergleiche aber den Beitrag von Boris Previšić in diesem Band (S. # ff.).
Quelle
„Die Tragödie des Einzelnen aus der Statistik der Millionen befreien“. Über Literatur und Frieden. In: Karl Müller, Werner Wintersteiner (Hg.): „Die Erde will keinen Rauchpilz tragen“. Krieg und Frieden in der Literatur. Innsbruck: StudienVerlag 2011 (Schriftenreihe Literatur Institut für Österreichkunde | Österreichisches Kompetenzzentrum für Deutschdidaktik, Band 25) ISBN 978-3-7065-5099-4, 34-49.
Literatur
